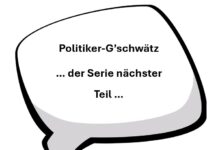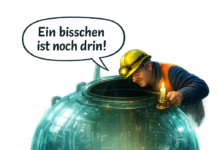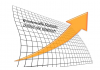Warum manche Antworten mehr sagen und anders ausfallen als der Fragende erwartet – und genau deshalb funktionieren.
Manche Fragen sind harmlos: „Wie war dein Wochenende?“ – Zack, kommt die Antwort. „Alles gut.“
Doch dann gibt es diese andere Kategorie. Fragen, die mit einem leisen Knistern in der Luft gestellt werden. Fragen, bei denen man spürt: Wenn ich jetzt ehrlich antworte, wird es unangenehm. Wenn ich ausweiche, wirke ich schmallippig. Und wenn ich zu direkt bin, hab ich vielleicht einen neuen Feind.
Beispiel gefällig? Auf einer Hochzeitsfeier. Frage (leicht zwinkernd): „Du zeigst heute aber wenig Dekolleté für den besonderen Anlass, oder?“ Antwort: „Schon. Aber ich hab auch nie behauptet, dass Lasagne eine Gemüsesorte ist.“ (Alternative Antworten: siehe am Ende des Blogs)
Was ist gerade passiert?
Kognitive Dissonanz auf Abruf.
Ein Begriff aus der Psychologie, eigentlich. Er beschreibt das Spannungsgefühl, das entsteht, wenn zwei Gedanken oder Überzeugungen sich widersprechen. Aber als rhetorisches Stilmittel ist er eine Granate.
Denn wer eine absurde, völlig aus dem Zusammenhang gerissene Antwort gibt, durchbricht die Erwartungslogik des Gegenübers. Der Fragende bleibt im Leerlauf. Statt zu kontern, sucht sein Gehirn erst mal nach Zusammenhang. Währenddessen: Du bist schon beim Buffet.
Warum das funktioniert?
Weil unser Hirn auf Kohärenz gepolt ist. Es will Zusammenhänge, Ordnung, Sinn. Wenn du den entziehst, entsteht ein Mini-Schock. Keine Angst, kein Trauma. Nur so eine Art inneres „Hä?“ – das lähmende Moment, das die Oberhand über jede Stichelei gewinnt.
Und nein, das ist nicht unfreundlich. Es ist entwaffnend. Denn es lässt keine offene Konfrontation entstehen. Stattdessen: absurde Komik. Und im besten Fall sogar ein Lachen.
Ein paar Formulierungsbeispiele für Fortgeschrittene:
Frage: „Du siehst heute aber müde aus.“ Antwort: „Ja, ich hatte einen Kampf mit einem Wombat**). Er hat gewonnen.“
Frage: „Wann heiratet ihr endlich?“ Antwort: „Sobald wir die letzte Staffel unserer Netflix-Serie überlebt haben.“
Frage: „Verdienst du eigentlich gut?“ Antwort: „Nur an geraden Tagen, wenn der Mond im Haus der Buchhaltung steht.“
Was ist der Mehrwert dieses Tricks?
- Selbstschutz: Du antwortest, ohne dich zu erklären oder zu rechtfertigen.
- Eleganz statt Konfrontation: Kein Streit, keine Passiv-Aggression, nur Verwirrung.
- Humor: Wer lacht, führt. Und Humor ist in sozialen Situationen oft der eleganteste Weg zur Entwaffnung.
- Gesellschaftlicher Spiegel: Wer solche Fragen stellt, merkt manchmal erst durch die absurde Antwort, wie übergriffig sie waren (siehe erstes Beispiel mit dem Dekolleté.
Fazit:
Man muss nicht jede Frage direkt beantworten. Und schon gar nicht jede Frage ernst nehmen. In einer Welt, in der jeder zu allem eine Meinung, ein Urteil und eine Nachfrage hat, wird die Kunst des kontrollierten Unsinns zur rhetorischen Gegenwehr.
Also: Beim nächsten Mal, wenn jemand fragt, warum du heute so still bist, sag einfach:
„Ich warte auf das Zeichen der Erdmännchen.“
Du wirst sehen, es wirkt Wunder.
Autor: Norbert W. Schätzlein
*) Alternative Antworten:
„Stimmt. Aber ich hab auch den Berliner Flughafen nicht zu verantworten.“
„Stimmt. Aber ich kann Kaffee riechen, bevor er gekocht wird – das gleicht’s wieder aus.“
„Korrekt. Aber immerhin habe ich nie den Euro eingeführt.“
„Stimmt. Aber am Tod von JFK bin ich unschuldig.“
**) Wombat:
Der Wombat – das heimliche Krafttier der Gelassenheit
In einer Welt, die von Reizüberflutung, Selbstoptimierung und Instant-Reaktionen lebt, wirkt er wie ein Zen-Mönch unter Pogo-Tänzern: der Wombat.
Dieses australische Beuteltier gräbt stundenlang in aller Seelenruhe sein Höhlensystem, bewegt sich mit der emotionalen Stabilität eines Steinbuddhas und schaut selbst einem heranrauschenden Feind mit einem Ausdruck entgegen, der irgendwo zwischen stoischer Missachtung und milder Verwirrung liegt. Keine Hektik, keine Panik – höchstens ein leichtes Schnauben, bevor er sich gemächlich in den nächsten Bau trollt.
Was wir vom Wombat lernen können?
- Reizverweigerung statt Reizreaktion
Während andere aufspringen, scrollen, kommentieren, bleibt der Wombat einfach sitzen. Weil er weiß: Nicht jede Frage verdient eine Antwort. Und schon gar nicht sofort. - Raum schaffen statt reagieren
Der Wombat gräbt – nicht, um sich zu verstecken, sondern um Raum zu schaffen. Für sich. Für Ruhe. Für Denkpausen. Ein Vorbild für alle, die statt Dauerreaktion lieber einmal durchatmen. - Stabilität ist kein Fehler – sondern Widerstandskraft
Wissenschaftler haben festgestellt, dass Wombats würfelförmigen Kot produzieren. Warum? Weil ihr Darmsystem darauf ausgelegt ist, selbst in unwegsamem Gelände nicht den Überblick zu verlieren. Wer das schafft, verliert auch im Meinungskampf auf LinkedIn nicht gleich die Fassung.
In einer Welt voller nervöser Pfauen, hyperventilierender Meinungsführer und sozialmedialer Posen wirkt der Wombat fast schon revolutionär: langsam, unbeeindruckt – und dadurch frei.
Vielleicht sollten wir also alle ein bisschen mehr Wombat sein.

Addendum:
Für Leser meines Blogs, die die Geduld aufbringen zu Ende zu lesen, gibt es jetzt noch ein Schmanckerl, insbes. für Cineasten. Die kognitive Dissonanz wurde tatsächlich schon mal filmisch umgesetzt und zwar in dem Filmklassiker mit Michael Caine: „PULP“, MALTA SEHEN UND STERBEN. Leichen waren seine Berufung! Hier findet sich folgendes Zitat als es einem Gast beim Essen zu bunt wurde mit der Borniertheit anderer Gäste an der Tafel: in gegenteiliger Weise fortgesetzt, Twidlitie; falls es so sei, wäre es möglich, falls es so wäre, würde es so sein, aber da es so nicht ist, ist es nicht so, das ist Logik und das sind die Worte von Lewis Carroll meine teure Lady, aber ich werd’s ein bisschen einfacher ausdrücken: verpissen sie sich (andernorts und höflicher zitiert mit: ... oder anders ausgedrückt: Sie haben keine Ahnung!)
Quelle: Lewis Carrolls philosophischem Essay „What the Tortoise Said to Achilles“
Wenn Ihnen der Artikel gefallen hat: Unterstützen Sie unsere Arbeit und Recherchen.